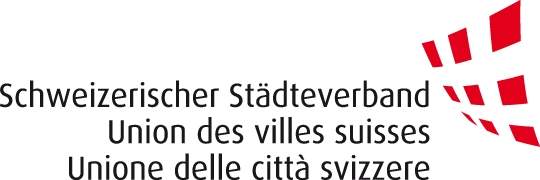Eine vielfältige Agglomerationspolitik stärkt die urbane Schweiz
Monika Litscher, Vizedirektorin Schweizerischer Städteverband
Städte und Agglomerationsgemeinden sorgen heute als die entscheidenden Leistungsträgerinnen für die Lebensqualität, den Wohlstand und den Fortschritt der Schweiz. Damit diese Agglomerationen attraktiv bleiben und nachhaltig resilient werden, müssen räumliche Prozesse stets zusammen mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen gestaltet werden. Diese herausfordernde komplexe Aufgabe, die zugleich eine strategische des Bundes ist, lässt sich nur im Verbund und Querschnitt lösen: Die urbane Politik braucht für ihre Aktivitäten vor Ort Unterstützung, Ressourcen und Wissen, und der Bund erreicht seine Ziele nur mittels kommunaler Projekte. Die konsequente Einhaltung des Artikels 50 der Bundesverfassung und die darin geforderte Berücksichtigung von Städten und Agglomerationen ist wichtig und tut besonders Not.
Alle Staatsebenen gemeinsam erreichen die nationalen Ziele
Das gilt auch für die vom Bund formulierten Ziele der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. Der alt Präsident des Städteverbands Kurt Fluri hat jüngst in einer Interpellation nachgehakt, wie es denn um deren Verankerung in der Agglomerationspolitik und die Umsetzungsunterstützung des Bundes für Städte und Agglomerationsgemeinden steht, damit die Ziele der Agenda 2030 erreicht werden. Die Bedeutung aller drei Staatsebenen zur Bewältigung der Schwerpunktthemen «Konsum und Produktion», «Klima, Energie und Biodiversität» sowie «Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt» wurde zwar seitens Bundesrats anerkannt. Doch statt konkrete neue Wege für ein Miteinander von Gesellschaft, Umwelt und Raum vorzuschlagen, wurde auf bestehende Aktivitäten, die laufende Evaluation der jetzigen Agglomerationspolitik 2016+ und die ausstehende Antwort auf das hängige Postulat von Nationalrat und Städteverbandsvorstandsmitglied Philipp Kutter vertröstet.
Das prominente Programm: Agglomerationsprogramm Verkehr
Vielfach wird die Agglomerationspolitik mit dem Programm Agglomerationsverkehr (PAV) gleichgesetzt. Dabei unterstütztder Bund die Agglomerationen finanziell bei der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. Das prominente Programm, inzwischen in der vierten Generation, ist für Städte und Agglomerationen eine sehr wichtige Massnahme, um Verkehrsinfrastruktur koordiniert zu entwickeln (s. Vernehmlassungsantwort des Städteverbandes). Die programmatische Unterstützung ist notwendig, damit die Agglomerationen ihre Ziele erreichen und flächeneffiziente, sichere und ressourcenschonende Mobilität ermöglichen können. Erfreulich ist, dass der öffentliche Verkehr, Velofahren und Zufussgehen explizit berücksichtigt werden. Eine Herausforderung besteht in der Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierung: Durch die Dekarbonisierung der Autos und die. zunehmende E-Mobilität fallen die Erträge aus den Mineralölsteuern zusehends weg. Die Kasse der PAV, der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds NAF muss daher mit neuen Mittel geäufnet werden. Wünschenswert ist aus Sicht der Städte zudem, dass bei Progammfinanzierung der mögliche Finanzierungsgrad des Bundesbeitrags auch wirklich einmal die maximalen 50% erreicht.
Das Programm Agglomerationsverkehr kann seine Wirkung für eine qualitätsvolle Mobilitätsentwicklung erst zusammen mit einer nachhaltigen Siedlungs-, Zentrums- und Freiraumentwicklung voll entfalten. Das betrifft die Siedlungsgebiete innerorts und die Verbindungen zwischen Agglomerationsgemeinden. Gerade diese Pendelbewegungen werden grösstenteils noch immer mit dem Auto, dem flächenineffizientesten Verkehrsmittel, absolviert. Die Wahl eines nachhaltigen Verkehrsmittels fällt oft weder leicht noch ist sie selbstverständlich. Aus Sicht der Politiksteuerung sollten zudem die in diesem Agglomerationsprogramm Verkehr etablierten, regional organisierten Trägerschaften massgeschneidert und zielführend in andere Politik- und Querschnittsbereiche weiterentwickelt werden.
Das kleine Mandat mit sozialräumlicher Kraft: Netzwerk Lebendige Quartiere
Welche Bedeutung die lokale Ebene, die öffentlichen Räume und die Quartierentwicklung als Gestalterinnen urbaner Transformationen haben, zeigt sich eindrücklich im «Netzwerk Lebendige Quartiere». Mittels einfacher Vernetzung tauschen sich sozialräumlich arbeitende Fachleute aus der ganzen Schweiz regelmässig zu aktuellen Themen aus und lernen gegenseitig von ihren Erfahrungen des Mitwirkens, ihren Reallaboren und der Bedeutung der Quartiere als Kraft im Kleinen. Solche niederschwelligen Angebote und Interaktionsmöglichkeiten auf Quartiersebene stärken den sozialen Zusammenhalt in Agglomerationen, da sie im Alltag und im öffentlichen Nahraum erfahrbar und wichtig sind. Es gilt sie zu schaffen, anzuerkennen, zu nutzen und weiterzuentwickeln.
Ein wichtiger Pfeiler für den Erfolg ist eine klar definierte Partizipation. Damit werden lokale Demokratien gestärkt, Beziehungen zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung gepflegt, die Identifikation mit dem Quartier, Ort und der Agglomeration gefördert. Gerade Handlungswissen führt oft zu neuen Ideen und stärkt das Vertrauen in Institutionen und die Demokratie an sich.
Idealerweise werden solche Massnahmen bereits jetzt in der Planungs-, Budget- und Politiksteuerung der nächsten Agglomerationspolitik verankert und gestärkt. Eine Erweiterung wäre aus Sicht der Städte wünschenswert, so dass das im Netzwerk erlangte Wissen zielgerichtet für Politik und Praxis greifbar gemacht werden kann. Denn nur wenn Geschichten des Gelingens weitererzählt und analysiert werden, entfalten sie ihre Wirkung in der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – und lassen sich co-kreativ weiterentwickeln.
Vielfältige, diverse Agglomerationen: Same same but different
Die Programme und Projekte der Agglomerationspolitik sind auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Sie alle verpflichten sich den noch immer aktuellen Zielen: hohe Lebensqualität, hohe Standortattraktivität, qualitätsvolle Siedlungsentwicklung und wirkungsvolle Zusammenarbeit. Ihre verschiedenen Schwerpunkte bewegen sich im Rahmen einer kohärenten Raumentwicklung, die den sozialen Zusammenhalt mit den räumlichen Herausforderungen denken will. Das ist auch gut so, denn ein Patentrezept für die Handhabe, die Bedürfnisse und die urbane Governance aller Agglomerationen gibt es nicht. Trotzdem bieten sich aufgrund gemeinsamer Herausforderungen ähnliche Chancen. Sie lassen sich mit einer je spezifischen Planung, konkreter Politik vor Ort und einer Prise Experimentierfreude nutzen und tragen vereint und künftig vielleicht noch etwas besser kuratiert zu einer starken Agglomerationspolitik bei – im Interesse der Agglomerationen!