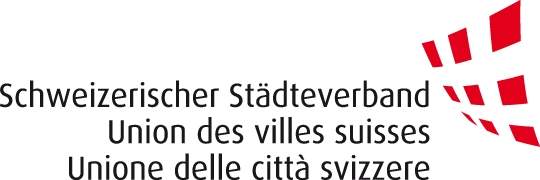Hilfe und Betreuung im Alter: Lücken müssen geschlossen werden
Franziska Ehrler, Leiterin Sozial- und Gesellschaftspolitik SSV, Mitglied der Planungsgruppe im Netzwerk altersfreundliche Städte
Im Gegensatz zu Pflegeleistungen, die von der Krankenversicherung übernommen werden, gibt es für Hilfs- und Betreuungsleistungen keine Vergütungen. Es ist jedoch im Interesse der Städte, dass ältere Stadtbewohner Zugang zu qualitativ guten Hilfs- und Betreuungsleistungen haben, damit sie möglichst lange ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen und an der Gesellschaft teilhaben können. Dadurch erhöht sich die Lebensqualität der älteren Menschen und ihrer Angehörigen, was letztlich auch den sozialen Zusammenhalt in der Stadt stärkt. Jene Städte, die einen Teil der Restfinanzierung im Pflegebereich übernehmen, können zudem Geld sparen, wenn verfrühte Heimeintritte verhindert werden können.
Wie kommen Betroffene zu den Angeboten?
Die Städte engagieren sich bereits heute auf vielfältige Art und Weise für ihre älteren Einwohnerinnen und Einwohner. Sie schliessen Angebotslücken, indem sie selber Angebote bereitstellen, Leistungsverträge mit privaten Akteuren abschliessen und das Freiwilligenengagement fördern. Sie vernetzen und koordinieren die verschiedenen Angebote und Akteure.
«Städte schliessen Angebotslücken, vernetzen und koordinieren.»
Eine der grossen Herausforderungen der Städte ist, niederschwellige Zugänge zu schaffen und so die betroffenen Personen zu erreichen. Sie haben dazu unterschiedliche Instrumente entwickelt: von Informationsangeboten, über die aufsuchende Altersarbeit bis zu Bedarfsabklärungsinstrumenten. Einige Städte entrichten zudem finanzielle Zuschüsse an Personen mit Hilfs- und Betreuungsbedarf in Privathaushalten oder in intermediären Strukturen.
Umfassende Alterspolitik braucht gesetzliche Grundlage
Damit Angebots- und Finanzierungslücken geschlossen werden können, braucht es alle drei Staatsebenen. Die Städte wünschen sich, dass der Bund den gesetzlichen Rahmen und die Kantone die notwendigen gesetzlichen Grundlagen schaffen für eine umfassende Alterspolitik, die auch Hilfe und Betreuung im Alter sicherstellt. Die Zuständigkeiten zwischen den drei Staatsebenen im Bereich der Bedarfserhebung, der individuellen Bedarfsabklärung, der Bereitstellung der Leistungen sowie der Koordination/Vernetzung und der Finanzierung sollten geklärt und gesetzlich festgehalten werden.
Die städtische Ebene sollte dabei ihr Engagement vor allem auf den Bereich der individuellen Bedarfsabklärung, die Schaffung von Zugängen und die Vernetzung der Angebote und Akteure konzentrieren können. Die Sicherstellung des Angebots und die Aufsicht ist Sache der Kantone, kann von diesen aber je nach innerkantonaler Aufgabenteilung an die kommunale Ebene delegiert werden. Die Definition des Leistungsniveaus, die Entwicklung eines einheitlichen Bedarfsabklärungsinstruments und die Finanzierungsverantwortung sollte aus Sicht der Städte primär von Bund und Kantonen übernommen werden.
Finanzierung darf nicht von der Wohnform abhängen
Ein zentrales Anliegen der Städte ist, dass die Finanzierung von Hilfs- und Betreuungsleistungen unabhängig von der Wohnform gewährleistet ist; sprich unabhängig davon, ob jemand in einem Privathaushalt, im betreuten Wohnen (intermediäre Strukturen, Wohnen mit Dienstleistungen) oder einem Heim lebt. Heute wird Hilfe und Betreuung im Heim von der EL bezahlt, im Privathaushalt nur sehr beschränkt. Anpassungen im Ergänzungsleistungsgesetz, wie sie die Motion «Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen» (18.3716 ) fordert, könnten hier einen wichtigen und unmittelbaren Beitrag leisten und mindestens für die Zielgruppe der EL-Beziehenden die Situation erheblich verbessern. Die Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf dürfte in der nächsten Zeit eröffnet werden. Der Städteverband hofft, dass der Entwurf Hilfs- und Betreuungsleistungen breit versteht und den Zugang für EL-Beziehende tatsächlich verbessert.
Städte lancieren innovative Projekte
Verschiedene Städte haben selbst nach Lösungen gesucht, um den Zugang zu Hilfs- und Betreuungsleistungen zu verbessern. Bern und Luzern haben beispielsweise Pilotprojekte mit sogenannten Betreuungsgutsprachen lanciert. In beiden Projekten haben EL-Beziehende und Personen knapp ausserhalb der EL Anspruch auf einzelfallbezogene Kostengutsprachen. In Luzern können in der Regel 3'000 Franken pro Jahr und Person gewährt werden, in Bern maximal 6'000 Franken.
«Betreuungsgutsprachen sind wirksam.»
Luzern hat sich soeben entschieden, das Projekt zu verstetigen. Und auch in Bern hat die Evaluation gezeigt, dass die Kostengutsprachen wirksam sind. Ein anderes Beispiel ist Aarau. Dort wird versucht mittels mobiler Altersarbeit in zwei Quartieren, den Zugang zu Hilfe und Betreuung niederschwelliger zu gestalten.
Das vollständige Positionspapier mit weiteren Beispielen aus Städten finden Sie unter www.staedteverband.ch.
| Hilfs- und Betreuungsleistungen umfassen beispielsweise administrative Hilfen (Rechnungen bezahlen, Steuererklärung); hauswirtschaftliche Dienste wie Putzen, Waschen oder Mahlzeitendienste; Fahrdienste; aber auch soziale Betreuung und Begleitung. Davon abzugrenzen sind Pflegeleistungen, die von der Krankenversicherung übernommen werden. |