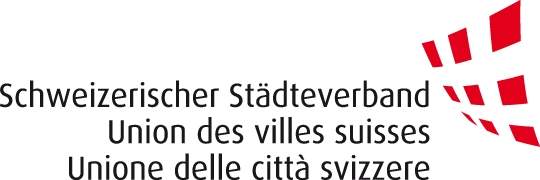Erneuerbare Energien fördern, Biodiversität schützen
Die Gefahr einer Strom- und Gasmangellage beschäftigt uns alle: die Behörden – der Bund, die Kantone, die Städte und Gemeinden – die Energieversorgungsunternehmen, die Wirtschaftsakteure und die Bevölkerung. Die gegenwärtige Situation ist vor allem auf den Krieg in der Ukraine und die Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland in verschiedene europäische Länder sowie auch auf die technisch bedingte und aus Sicherheitserwägungen erfolgte Stilllegung eines Teils der Atomkraftwerke in Frankreich zurückzuführen.
Der SSV unterstützt voll und ganz die Energiestrategie 2050, die darauf abzielt, die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten, insbesondere durch die Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz. Auch wenn die aktuelle Krise die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit zutage trägt, soll dies kein Grund sein, die Strategie in Frage zu stellen. Vielmehr muss ihre Umsetzung beschleunigt werden.
Kurzfristig geht es darum, den Elektrizitäts- und Gasbedarf auch im Winter decken zu können. Der SSV begrüsst deshalb die Einrichtung der Elektrizitätsreserve für den Winter, bestehend aus der Wasserkraftreserve, Reservekraftwerken und Notstromaggregaten. Längerfristig muss der Ausbau einheimischer erneuerbarer Energieressourcen aber deutlich beschleunigt werden. Das doppelte Ziel – die Klimaneutralität und die Verringerung der Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern – muss beibehalten werden. In diesem Zusammenhang ist das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, das derzeit in den eidgenössischen Räten beraten wird, von entscheidender Bedeutung.
Ehrgeizige Ziele in einem technologieneutralen Umfeld
Die Richtwerte durch verbindliche Zielwerte für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu ersetzen, ist unerlässlich, wenn bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden soll. Diese Ziele müssen dabei auch ehrgeizig genug sein, damit die Schweiz langfristig auf nichterneuerbare Energieträger verzichten kann, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. So begrüsst der SSV die Verschärfung der gesteckten Ziele, wie vom Ständerat vorgeschlagen. Da die Wasserkraft und die Photovoltaik die beiden Hauptträger der Produktion erneuerbarer Energie darstellen, sollten auch für die Photovoltaik Zielwerte für 2035 und 2050 festgelegt werden.
Generell hat die Förderung der erneuerbaren Energien technologieneutral zu erfolgen und darf sich nicht auf die Förderung der Produktion erneuerbarer Elektrizität beschränken. Aus diesem Grund schlägt der SSV hinsichtlich der Energieproduktion im Winter vor, so rasch wie möglich Ausschreibungen zu lancieren, nicht nur für Wasserkraftwerke und Solaranlagen, sondern auch für andere Energiegewinnungstechnologien wie Windkraft und, unter bestimmten Bedingungen, auch für die Kraft-Wärme-Kopplung.
Effiziente Förderung erneuerbarer Energien …
Nicht nur die Fortführung, sondern auch die Stärkung und Optimierung des Fördersystems sind essentiell, wenn es darum geht, die Produktion erneuerbarer Energien rasch auszubauen. Der SSV hat mit Genugtuung den Vorschlag des Ständerates zur Kenntnis genommen, ein differenziertes Fördersystem einzuführen, das Investitionsbeiträge, die harmonisierte Vergütung für Strom aus Kleinanlagen sowie gleitende Marktprämien für Strom aus grossen Anlagen kombiniert. Ein solches System ermöglicht es, die jeweiligen Merkmale der zu fördernden Anlage zu berücksichtigen: Grösse, Anlage mit oder ohne Eigenverbrauch und verwendete Technologie.
In der Schweiz muss der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien zweifellos über die Stärkung der Photovoltaik erfolgen. Der SSV geht davon aus, dass bei grossen Photovoltaikanlagen die Effizienz gesteigert wird, wenn entweder an der Auktion von Investitionsbeiträgen (mit einer Einmalvergütung von maximal 60%) oder am System der gleitenden Marktprämie teilgenommen wird. Bei kleinen Anlagen wird die Harmonisierung der Vergütungstarife das Vergütungssystem transparenter und fairer gestalten. Darüber hinaus darf nicht unterschätzt werden, dass die vom Ständerat vorgeschlagenen Instrumente dazu beitragen, die Rentabilität von Photovoltaikanlagen mit oder ohne Eigenverbrauch zu wahren. Dies ist besonders für Städte mit einem hohen Anteil von Mietwohnungen wichtig ist, da deren Eigentümer nicht von den Vorteilen des Eigengebrauchs profitieren.
… mit Rücksicht auf die Biodiversität …
Um die Ziele des Ausbaus erneuerbarer Energien erreichen zu können, ist die Abwägung der Interessen des Natur- und Umweltschutzes einerseits und der Nutzung der natürlichen Ressourcen andererseits, unumgänglich. Mit dem Klimawandel ist die Abnahme der Biodiversität die grösste Herausforderung beim Umweltschutz. Die Biodiversität steht wegen der Zersiedlung, der Landwirtschaft und der Energieproduktion unter Druck. Der SSV ist der Ansicht, dass gewisse landschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Bekämpfung der Klimakrise vertretbar sind. Das gilt insbesondere für Windkraftanlagen und auch für Solaranlagen in den Bergen, die ein besonders interessantes Potential für die winterliche Energieerzeugung darstellen. Andererseits lehnt der SSV den Bau von Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien in Biotopen von nationaler Bedeutung ab.
… und ohne den Ausbau der Wärmenetze zu vergessen …
Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien spielt der Ausbau der Wärmenetze in urbanen Zentren eine wichtige Rolle bei der Realisierung des «Netto-Null»-Ziels. In dicht bebauten Städten ist der Anschluss an ein Wärmenetz aus Platz-, Lärm- und Denkmalschutzgründen häufig die einzige Alternative zu fossilen Heizungen. Die Planung und Realisierung von Wärmenetzen ist aber mit hohen Anfangsinvestitionen, langen Amortisationszeiten und somit auch mit finanziellen Risiken verbunden. Die Absicherung der Risiken durch Mittel aus dem Technologiefonds, wie ihn der Bundesrat im CO2-Gesetz vorschlägt, ist zwar eine willkommene Initiative, reicht aber nicht aus. Um den gewünschten Effekt zu erreichen, müssen die Städte die Möglichkeit haben, in bestimmen Zonen die Pflicht zum Anschluss an ein Wärmenetz einzuführen. Der SSV fordert darüber hinaus die Schaffung eines Umlauffonds, um das nötige Kapital bereitzustellen. Ein solcher Umlauffonds sollte vom Bund verwaltet und geäufnet werden und es ermöglichen, Städten, Gemeinden und anderen Akteuren, die mit der Planung und dem Bau von Wärmenetzen betraut sind, zinsgünstige Darlehen zu gewähren.
Die Finanzierung
Die Förderung erneuerbarer Energien ist durch den Netzzuschlag zu finanzieren. Um die nötigen Mittel bereitstellen zu können, fordert der SSV eine dynamische Gestaltung des Netzzuschlages, dessen Höhe und Dauer sich an der Realisierung der Ziele (Ausbaustand der erneuerbaren Energien, Versorgungssicherheit etc.) und an den Marktbedingungen (Strompreis etc.) orientieren soll. Um ausserdem jederzeit über die nötigen Mittel verfügen zu können, muss der durch den Netzzuschlag gespeiste Fonds auch Schulden aufnehmen können. Da zur Sicherung der Energieproduktion im Winter technologieneutrale Ausschreibungen notwendig sind, wird der vom Bundesrat vorgeschlagene Winterzuschlag von 0.2 Rappen/kWh sicherlich nicht ausreichen. Der SSV fordert deshalb, eine Erhöhung des Winterzuschlags in Betracht zu ziehen.