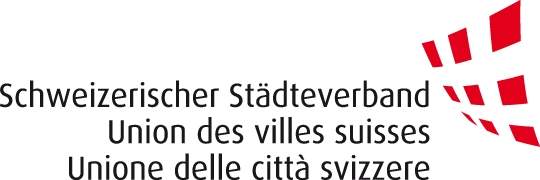«Eine dichte Stadt braucht nicht mehr, aber bessere Aussenräume»
Wie steht es um die Innenentwicklung in Winterthur? Gibt es dafür ein spezifisches Programm?
Die Winterthurer Bevölkerung wächst seit zwei Jahrzehnten stetig an, um ein bis anderthalb Prozent pro Jahr. Bisher konzentrierte sich die Innenverdichtung typischerweise auf die Umnutzung ehemaliger Industrieareale. Diese Potenziale sind aber bald ausgeschöpft.
Es ist klar, dass Winterthur weiterwachsen wird. Darum haben wir schon vor vier Jahren «Winterthur 2040» vorgelegt, ein städtebauliches Leitbild mit klarer Haltung zur Innenentwicklung. Verdichtet werden soll nicht beliebig, sondern gezielt dort, wo die Erschliessung optimal ist.
Welche Gegebenheiten seitens Kanton und Bund muss die Stadt vorfinden?
Fast die Hälfte der Stadt Winterthur ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) gelistet. Wie stark der Ortsbildschutz in Konflikt mit der inneren Verdichtung steht, muss sich in den nächsten Jahren zeigen.
Viele Städte beschränken sich in ihrer Innenverdichtung auf Arealentwicklungen; wie ist es in Winterthur?
Mit «Winterthur 2040» haben wir eine Gesamtschau entwickelt, die zugleich Grundlage des neuen Richtplans ist. Ein Höhenentwicklungskonzept legt fest, wo Hochhäuser möglich sind. Und erste Masterpläne regeln die Entwicklung an «Verdichtungs-Hotspots», etwa rund um einzelne Quartierbahnhöfe. Die Erneuerung der Bau- und Zonenordnung (BZO) erfolgt in einem nächsten Schritt. Wir streben keine flächendeckenden Aufstockungen an, wollen aber gezielt dort Verdichtung ermöglichen, wo es städtebaulich Sinn ergibt.
Welche möglichen Pisten kann eine Stadt verfolgen, um die Verdichtung im Bestand voranzutreiben?
Bisher wurde oft Altes abgebrochen um Neues zu bauen. Doch so können wir unsere ehrgeizigen Klimaziele (Netto Null CO2 bis 2040) nicht erreichen. Denn sehr viel graue Energie ist in der Bausubstanz gespeichert. Gleichzeitig ist Bauen im Bestand komplexer und manchmal auch teurer als Abbruch und Neubau. Hier prüfen wir Anreizsysteme und wollen als Stadt selbst Vorbild sein. Beispielsweise planen wir die Erweiterung von Schulanlagen ohne Abbruch: Eher setzen wir z.B. einen Klassentrakt auf eine bestehende Turnhalle drauf oder nutzen Bauten um.
Welche Chancen bietet die innere Verdichtung für Winterthur?
Winterthur ist bis anhin sehr flächig gebaut und hat keine besonders dichte Baustruktur. Infrastruktur wie ÖV oder Fernwärme «rentiert» aber besser, wenn die Dichte steigt. Auch kulturelle und gastronomische Angebote profitieren von mehr Einwohnenden.
Gibt es konkrete Beispiele, die zeigen, wie eine Verdichtung sich positiv auf ein Quartier, bzw. letztlich die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner auswirkt?
Nach dem wirtschaftlichen Niedergang der Firma Sulzer standen Ende der Neunzigerjahre 22 Hektar mitten in der Stadt leer. Heute ist dieses Gebiet fertig entwickelt undsehr belebt. Neue Bürobauten, Lofts, Hochschulgebäude aber auch Kleingewerbe, Kultur und Gastronomie in einem Mix aus historischen und neuen Gebäuden: Das Quartier lebt!
Welche flankierenden Massnahmen sind Ihres Erachtens wichtig, damit die innere Verdichtung die Lebensqualität erhöht und nicht verschlechtert?
Eine dichte Stadt braucht nicht mehr, aber bessere Aussenräume und ein gesundes Stadtklima. Stadtgrün Winterthur hat in den letzten drei Jahren 1000 zusätzliche Bäume gepflanzt. Die Kaltluftkorridore sind im kommunalen Richtplan gesichert. Und ebenso der «Stadtrandpark»: Winterthur ist von einem grünen Saum umschlossen, der als Erholungs- und Naturgebiet eine grosse Qualität darstellt und den wir schützen und entwickeln wollen.
Damit der Verkehr in einer wachsenden Stadt fliesst, werden Velorouten ausgebaut, der ÖV bevorzugt und der Fussverkehr durch gezielte Beruhigung attraktiv gemacht. Ziel ist eine Stadt, in der man innert weniger Minuten alles erreicht, was man zum Leben braucht – und zwar auch ohne Auto.