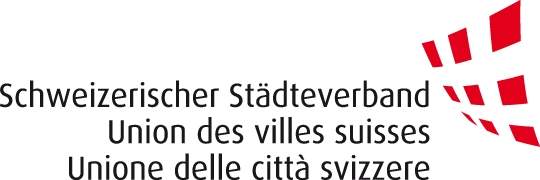Verkehrsräume in Lebensräume umgestalten: ein klares Bedürfnis der Stadtbevölkerung
Städte sind seit jeher Orte des Handels, der Begegnungen und Beziehungen. Mobilität von Menschen, Informationen und Güter ist eine Voraussetzung und ein Treiber für städtische Entwicklungen. Die Bedürfnisse an diese Mobilität verändern sich mit der Gesellschaft. Wir sind heute mobiler denn je; doch der Platz ist begrenzt. Die zunehmenden Mobilitätsbedürfnisse müssen daher kompatibel sein mit allen Aspekten des Lebens im immer dichter genutzten Raum. Das Positionspapier «Für eine effiziente, umwelt- und sozialverträgliche urbane Mobilität des Städteverbands» zeigt auf, welche Akzente heute die Städte in der Verkehrspolitik setzen und in Zukunft noch verstärken wollen. Dazu gehört die Förderung und der weitere Ausbau der flächeneffizienten Mobilität, wozu die aktive Mobilität (Fuss- und Veloverkehr), der öffentliche Verkehr sowie die Angebote der geteilten Mobilität (Carsharing, Bikesharing, etc.) zu zählen sind. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) soll angesichts seines vergleichsweise hohen Flächenverbrauchs und seiner negativen Umweltauswirkungen eine subsidiäre Rolle spielen. Angesichts des Bevölkerungswachstums in den Städten und dem begrenzten Platz ist eine solche Priorisierung alternativlos. Eine qualitativ hochstehende Innenentwicklung und eine flächeneffiziente Mobilität sind das Zwillingspaar einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Temporeduktionen, mehr Platz für den Fuss- und Veloverkehr und die vermehrte Begrünung und Entsiegelung sind die notwendigen Zutaten, um eine hohe Lebens- und Freiraumqualität im urbanen Raum sicherzustellen.
In den alltäglichen, verkehrsplanerischen Niederungen wird um jeden Quadratmeter Strassenfläche gefeilscht und gerungen. Wollen Städte sichere Velorouten realisieren und müssen dafür ein paar Parkplätze aufheben, sind die Widerstände gross. Bisweilen sind in der öffentlichen Debatte Stimmen zu vernehmen, welche den Städten vorwerfen, eine ideologisierte Verkehrspolitik zu betreiben, welche an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeiziehe. Dass genau das Gegenteil der Fall ist, zeigt die breit angelegte Studie «Mobilität in Schweizer Städten», welche das Forschungsinstitut gfs.bern in Auftrag der Städtekonferenz Mobilität und 17 teilnehmenden Städten und Agglomerationsgemeinden durchgeführt hat. Keine andere Studie liefert derzeit fundiertere Daten zum Mobilitätsverhalten und der verkehrspolitischen Einstellung der Bevölkerung in Schweizer Städten, denn die Befragung ist geografisch breit abgestützt und basiert auf einer repräsentativen Stichprobe von über 15'000 Antwortenden.
Eindeutige Antworten auf die verkehrspolitische Gretchenfrage
Dass die Verkehrspolitik der Städte von einer grossen Mehrheit der Stadtbevölkerung mitgetragen wird, zeigt sich exemplarisch bei der Frage nach den Präferenzen punkto Flächenallokation. Oft ist für das Eine nicht mehr Fläche zu haben, ohne dem Anderen Fläche wegzunehmen. Die Beantwortenden mussten beispielsweise entscheiden, ob sie viel Platz für den rollenden Motorfahrzeugverkehr und Parkplätze zulasten der Flächen für den Veloverkehr bevorzugen oder umgekehrt. Der Frageblock enthielt dieselbe Gegenüberstellung von MIV mit dem Fussverkehr, mit verkehrsfreiem Raum und mit mehr Raum für den öffentlichen Verkehr. Das Verdikt auf die Flächenallokationsfrage könnte eindeutiger nicht sein: Satte Mehrheiten zwischen 59% und 79% wollen weniger Platz für den MIV zugunsten von Velo, Zufussgehen, öV und verkehrsfreien Zonen. Eindrücklich ist, dass dieses Verdikt in allen Städten sehr ähnlich ausfällt – von Sion über Basel bis nach Schaffhausen. Am klarsten fällt die Haltung gegen viel MIV-Flächen in der Stadt Bern aus, mit Anteilen über 75% zugunsten der Nicht-MIV-Nutzungen. Dass in allen untersuchten Städten die Mehrheiten in dieser zentralen Frage so ähnlich ausfallen, ist bemerkenswert, denn die Studie zeigt auch, dass durchaus grosse Unterschiede bei der Nutzung der Verkehrsmittel bestehen. So nutzen in Bern gerade mal 15% der Befragten das Auto regelmässig für den Weg zur Arbeit oder zur Ausbildung, währenddessen dieser Anteil sich in der Stadt Sion auf 51% beläuft. Bei den Lösungsansätzen für eine optimale Ausgestaltung der Verkehrsinfrastrukturen scheinen sich die Städterinnen und Städter also ziemlich einig zu sein, unabhängig davon, wie sie aktuell unterwegs sind. Angesichts des knappen städtischen Raums und der klaren Antworten muss der motorisierte Individualverkehr möglichst vermieden, auf andere Verkehrsmittel verlagert, verträglich abgewickelt und vernetzt werden. Weniger MIV befreit die Strassen. Die gfs-Studie zeigt, dass Stau, ein überlastetes Verkehrssystem und Verkehrsbehinderungen am häufigsten für Unzufriedenheit mit der Mobilitätssituation führen, gefolgt von mangelnden Parkplätzen. Wenig erstaunlich ist, dass diese Unzufriedenheit in denjenigen Städten am höchsten ausfällt, in denen das Auto eine grössere Rolle spielt. Doch scheinen auch viele Leute, die regelmässig mit dem Auto unterwegs sind, zum Schluss zu kommen, dass ein weiterer Ausbau der Infrastrukturen für den MIV in den meisten Situationen das falsche Rezept ist. Bezeichnend dafür ist, dass zwar 44% der Befragten einen Parkplatzmangel beklagen, bei der bereits erwähnten Frage zur Priorisierung der verkehrspolitischen Massnahmen aber nur gerade 24% mehr Parkplätze im öffentlichen Raum oder in Parkhäusern möchten. Dieser Wunsch landet damit abgeschlagen auf den hinteren Rängen der verkehrspolitischen Prioritätenliste der Stadtbevölkerung.
Mehr Grünflächen: mehr Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung
Aufgrund des Klimawandels wird in den Städten vermehrt diskutiert, wie die Strassenräume auszugestalten sind, damit die hohen Temperaturen in den urbanen Hitzeinseln abgemildert werden können. Die gfs-Studie zeigt, dass der Wunsch nach mehr Grünflächen entlang der Strassen bei der Bevölkerung ein grosses Thema ist. Denn dieser Wunsch schwingt stets oben aus, wenn die Leute angeben, für welche verkehrspolitischen Massnahmen künftig mehr Geld ausgeben werden sollte. Weitere starke Wünsche sind der Ausbau der Veloinfrastruktur und mehr Stadträume, in denen man sich wohlfühlt. Auch hier also ein starkes Plädoyer für eine Transformation von Verkehrs- in Lebensräume mit einer hohen Aufenthaltsqualität und attraktiven Bedingungen für die aktive Mobilität – ein verkehrspolitisches Kernanliegen des Städteverbands angesichts der nötigen Siedlungsentwicklung nach innen.
Begegnungszonen und Tempo 30 sind breit anerkannte Erfolgsmodelle
Begegnungszonen (Vortrittsberechtigung für Menschen zu Fuss und Höchstgeschwindigkeit von 20km/h für Fahrzeuge) sowie Tempo 30 sind für Städte Erfolgsmodelle. Sie sind eine Schlüsselmassnahme, damit sichere und attraktive Strassenräume für alle Verkehrsteilnehmende entstehen können. Sie reduzieren den Lärm und fördern eine hohe Aufenthaltsqualität und einen optimalen Verkehrsfluss. Aktuell gerät Tempo 30 auf Hauptverkehrstrassen auf Bundesebene und in einigen Kantonen allerdings zunehmend unter Druck, trotz der hinreichend belegten positiven Wirkungen. Die gfs-Studie zeigt auf, dass Begegnungszonen und Tempo 30 einem grossen Bedürfnis der Stadtbevölkerung entsprechen: Knapp 80% der Befragten, die an Strassen mit Tempo 30 oder an einer Begegnungszone (Tempo 20) wohnen, erachten die geltende Geschwindigkeit als gerade richtig. An Tempo-50-Strassen hingegen wünscht sich ein Drittel bis die Hälfte der Befragten eine Temporeduktion. Angesichts der eindeutigen Bedürfnisse der Bevölkerung müssen sich die Städte mit Vehemenz gegen die Angriffe auf diese Errungenschaften wehren.
Potenziale bei der aktiven und geteilten Mobilität
Das Zufussgehen ist unbestritten die gesündeste, umweltfreundlichste und eine der beglückendsten Arten der Fortbewegung. Und es hat Potenzial, wichtiger zu werden: 67% der Befragten der gfs-Studie geben an, sich vorstellen zu können, künftig mehr zu Fuss zu gehen. Städte sollten sich noch intensiver darüber Gedanken machen, wie dieses Potenzial möglichst gut ausgeschöpft werden kann. Die Vorteile liegen auf der Hand: Verkehrssicherheit, Aufwertung und Klimaanpassung der Strassenräume. Auch beim Veloverkehr weist die Studie auf schlummernde Potenziale hin, wobei aktuelle Sicherheitsdefizite für viele Menschen eine grosse Hürde darstellen: Jede/Jeder fünfte Befragte gibt an, dass sie/er auf das Velofahren verzichtet, weil es als zu gefährlich empfunden wird.
Schliesslich sind auch die Angebote der geteilten Mobilität (Shared Mobility) ein wichtiger Bestandteil einer flächeneffizienten Mobilität. Die Befragung zeigt, dass geteilte Velos und eBikes insbesondere in denjenigen Städten eine zunehmend wichtige Rolle spielen, wo sehr dichte und grosse Bikesharing-Angebote, bereitgestellt werden. In Bern beispielweise geben 38% der Befragten an, schon mal ein Bikesharing-Angebot benutzt zu haben. Die Integration solcher neue Mobilitätsangebote in das städtische Verkehrssystem und deren Vernetzung mit den klassischen Verkehrsmitteln ist voranzutreiben.