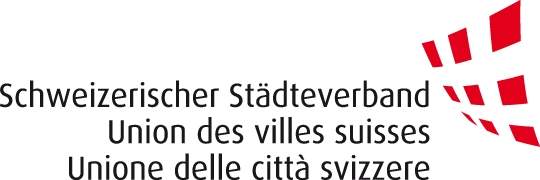Die Städte in den Medien - Kulturförderung in den Städten
In vielen Schweizer Städten ist eine verstärkte Auseinandersetzung mit Kulturförderung zu beobachten. Die Städte verfolgen dabei unterschiedliche, aber jeweils innovative Strategien, die Kultur als integralen Bestandteil der Stadtentwicklung verstehen. Dennoch erntet die Umsetzung von Kulturprojekten auch immer wieder Kritik, aufgrund Diverser Diskussionen über Anspruch auf Diversität, künstlerischer Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung.
In Uster bildet das sogenannte «Kulturgelage» das Herzstück eines neuen partizipativen Ansatzes. Das jährliche Treffen bringt Kulturschaffende, Verwaltung, Politik und Wirtschaft an einen Tisch – mit dem Ziel, Kulturförderung als gemeinsames Anliegen zu begreifen. Parallel dazu schafft die «Nashornrunde» informelle Räume, in denen konkrete Projekte wie offene Bühnen oder Literaturformate entstehen. Das Kulturleitbild 2020–2028 fördert bewusst dezentrale, spontane und niederschwellige Angebote – mit dem Ziel, Kultur in den Alltag zu integrieren. haben in Fribourg die Künstlerin Joséphine de Weck und der Jazzpianist Stefan Aeby ein innovatives Projekt initiiert, das die Bevölkerung dazu einlädt, weniger bekannte Stadtviertel durch eine künstlerische Klangreise zu entdecken. Die Audioführung «Elles regardent la ville» kombiniert Texte und Musik und führt die Teilnehmenden durch nicht-touristische Quartiere, wodurch versucht wird, neue Perspektiven auf die Stadt zu eröffnen. (Zürcher Oberländer: 12.03., La Liberté 15.04.)
Kultur im Spannungsfeld: Kulturförderung der Städte im öffentlichen Diskurs
Mehrere Schweizer Städte sehen sich mit wachsenden Erwartungen an ihre Kulturförderung konfrontiert. Kritik wird insbesondere dort laut, wo Anforderungen an Vielfalt und Transparenz mit Auswahlverfahren, inhaltlichen Prioritäten und künstlerischer Freiheit kollidieren. Die Stadt Zürich setzt sich aktiv für eine möglichst inklusive, diverse und zukunftsorientierte Kulturlandschaft ein. So äusserte der FDP-Politiker Florin Capaul Bedenken hinsichtlich der künstlerischen Auswahlkriterien und sprach von einer möglichen Einschränkung der Kreativität durch administrative Prozesse. Die Stadt Zürich nimmt solche Rückmeldungen ernst und ist bestrebt, im Dialog mit Kulturschaffenden und Publikum eine lebendige und zugleich zugängliche Theaterszene zu ermöglichen, in der künstlerische Qualität und gesellschaftliche Relevanz kein Widerspruch sein müssen.
Seit 2024 setzt sich in Bern eine spartenübergreifende Kulturkommission für eine neue Organisation des Kulturbereichs ein, die Perspektivenvielfalt und Gleichbehandlung in allen Sparten ermöglicht. Die Kulturkommission hat aktuell mit der Herausforderung mit einer öffentlichen Debatte, die Fragen hinsichtlich diskriminierender Haltungen und politischer Unabhängigkeit aufwarf. Die Stadt nimmt diese Kritik ernst und hat mit einer sorgfältigen Aufarbeitung reagiert. Geplant sind unter anderem eine Mediation sowie die Einführung eines verbindlichen Verhaltenskodexes, um das Vertrauen in die neue Kommissionsarbeit zu festigen und die Kulturförderung weiterzuentwickeln. (Der Bund: 21.03., Tages-Anzeiger: 29.03., Der Bund, 29.3., Berner Zeitung 15.04.)