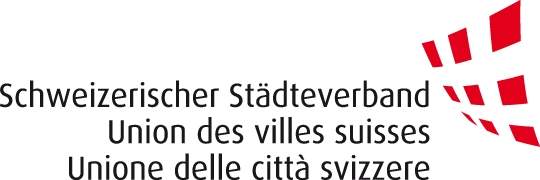Die Städte begrüssen die zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung
Nach dem Bundesgerichtsentscheid von 1984 wurden auf kantonaler Ebene verschiedene Massnahmen umgesetzt, um die verfassungswidrigen Auswirkungen der Heiratsstrafe zu mindern. Auf Bundesebene gab es ebenfalls diverse Versuche, das Steuersystem für verheiratete Paare anzupassen. 2022 reichten schliesslich die FDP-Frauen die Volksinitiative für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung ein. In der Folge wurde vom Bundesrat ein Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die Änderung des Steuersystems auf Gesetzesebene und nicht auf Verfassungsebene regeln soll.
Der Städteverband drückte sich bereits in der Vernehmlassung positiv gegenüber der Vorlage aus. Aus Sicht der Städte steht der Bund in der Pflicht, eine verfassungskonforme Ehepaarbesteuerung bei der direkten Bundessteuer zu erwirken. Die Individualbesteuerung wird als einziges Steuermodell dem sozialen, gesellschaftlichen und sozioökonomischen Wandel der letzten Jahrzehnte gerecht. Durch die Systemänderung wird die Gleichstellung der Geschlechter und Diversität der städtischen Lebensmodelle gleichberechtigt abgebildet.
Die Einführung der Individualbesteuerung ist auch ein volkwirtschaftlicher Erfolg, denn sie steigert insbesondere die Anreize zur Erwerbstätigkeit für Zweitverdienende, da diese flexibler auf Veränderungen in der Steuerlast reagieren können. Das grösste Potenzial für positive Beschäftigungseffekte besteht gemäss Botschaft des Bundesrates bei verheirateten Zweitverdienenden. Aufgrund der positiven Erwerbsanreize für Zweitverdienende wird eine höhere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt erwartet, was positive Auswirkungen auf die Chancengleichheit und die Wirtschaftsleistung der Schweiz hat.
Darüber hinaus wird mit dem Gesetz die finanzielle Unabhängigkeit beider verheirateter Personen gestärkt und ihre Altersvorsorge sowie die Absicherung im Falle einer Scheidung verbessert. Dies trägt ebenfalls zur Gleichstellung der Geschlechter bei und steht auch im Einklang mit der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum nachehelichen Unterhalt, die das Prinzip der Eigenversorgung nach der Scheidung betont.
Nebst den sozialen Aspekten würde die Vorlage auch volkswirtschaftliche Vorteile mit sich bringen: Gerade im Hinblick auf die aktuelle Arbeits- und Fachkräfteknappheit ist es zentral, das Potenzial von Frauen noch besser zu nutzen und bestehende Hürden für den Verbleib in der Erwerbstätigkeit und beim Wiedereinstieg abzubauen.
Die Städte forderten eine möglichst pragmatischen und aufkommensneutralen Steuersystemwechsel, um die angespannte finanzielle Lage auf Bundesebene nicht weiter zu verschlimmern. Das Parlament hat mit einem Kompromiss, der Mindereinnahmen von rund 600 Millionen Franken vorsieht, einen gangbaren Weg gefunden. Ebenfalls wurde die gezielte Entlastung von Familien mit einem Kinderabzug von 12'000 Franken, den die Städte gefordert haben, in der Endfassung berücksichtigt.
Die Differenzbereinigung im Ständerat kam einem Krimi gleich, die Parteilinien wurden strikt eingehalten, weshalb bei jeder Differenz ein Stichentscheid nötig wurde. Die Schlussabstimmung der Sommersession wurde mit Spannung erwartet, eine einzige Stimme konnte den Unterschied zwischen Steuergerechtigkeit und -ungerechtigkeit ausmachen. Am 20. Juni fällte das Parlament schliesslich den Entscheid, mit 101:93 Stimmen, die verfassungswidrige Heiratsstrafe abzuschaffen und mit dem Gegenvorschlag zur FDP-Frauen Initiative die zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung einzuführen.