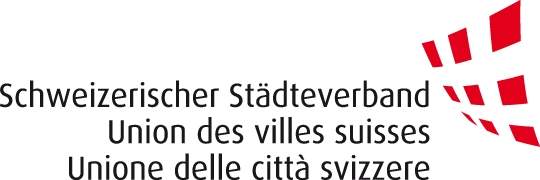Altersgerechte Wohn- und Lebensumgebungen
Prof. Valérie Hugentobler, Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit Lausanne (HETSL | HES-SO), Soziologin und Expertin für Sozial- und Alterspolitik.
Aus der fünften Ausgabe des Age Reports, der sich dem Thema Nachbarschaft widmet, geht hervor, dass die meisten älteren Menschen in der Schweiz selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben und ihre Wohnsituation schätzen. Wenn sie fragiler werden, ist es oft der Unterstützung durch ihre Angehörigen, durch Hilfs- und Pflegedienste sowie manchmal auch dem Beistand ihrer Nachbarn zu verdanken, dass sie bei sich zu Hause weiterwohnen können. Die Studie geht der Frage nach, wie das soziale Umfeld die Lebensbedingungen dieser alternden Bevölkerungsgruppe mit signifikant anderen Bedürfnissen als jene anderer Altersgruppen beeinflussen kann. Ältere Menschen haben spezifische Bedürfnisse, die über die Barrierefreiheit hinausgehen: Sie brauchen eine sichere, überschaubare Umgebung, welche die wichtigsten Dienstleistungen in der Nähe bietet, aber auch soziale Anbindung begünstigt. Damit diese Menschen bis ins hohe Alter selbstständig leben können, muss der Zugang zu angepassten und finanziell erschwinglichen Wohnungen sowie zum Mobilitätsangebot und zu einem unterstützenden nahen Umfeld gewährleistet sein. Das bedeutet, dass über die medizinische Sichtweise des Altwerdens hinausgedacht werden muss, um eine aktive Teilnahme an der Gesellschaft zu fördern.
Geschätztes, aber kaum angepasstes Wohnen
Generell ist das Wohnen gegenwärtig immer noch kaum an das Altwerden angepasst. Nur ein Drittel der Wohnungen gilt als barrierefrei. Oft erbaut bevor einschlägige Normen in Kraft gesetzt wurden, sind dort in der Zwischenzeit kaum Anpassungen für ältere Bewohnerinnen und Bewohner vorgenommen worden. Ältere Menschen, die sich in den letzten Jahren für einen Umzug entschieden haben, wählten in der Regel eine angepasste Wohnung oft in einem neueren Gebäude. Doch die Wohnmobilität ist bei Menschen im Rentenalter nach wie vor sehr gering, auch wenn ein Wille zur Selbstbestimmung erkennbar ist, der in der Suche nach diversifizierten Wohnformen zum Ausdruck kommt. So gibt es etwa begleitetes Wohnen, Alters-WGs oder generationsübergreifendes Wohnen. Diese Modelle fördern die Selbständigkeit und verringern gleichzeitig die soziale Isolation. Die Erschwinglichkeit hindert jedoch die Wohnmobilität älterer Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen, ganz besonders alleinlebende Frauen.
Die Bestandteile eines hochwertigen Wohnumfelds
Das Wohnumfeld spielt eine entscheidende Rolle für die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation. Ältere Menschen legen Wert auf die Qualität der Nachbarschaft, Ruhe, das Vorhandensein von Grünflächen, Infrastruktur und die Möglichkeit, mit anderen Generationen zu interagieren. An der Stadt schätzen sie nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsdienste und nahe öffentliche Verkehrsmittel. Andererseits wird die Lärmbelastung öfter erwähnt als auf dem Land sowie ein Gefühl des Fremdseines in der Umgebung. Manche Menschen haben zuweilen das Gefühl, dass sie das Quartier, das sie seit langem bewohnen, nicht mehr kennen. Zum Beispiel kann eine rasche Stadtentwicklung ein Gefühl der Orientierungslosigkeit hervorrufen.
Das Quartier als Raum der Nähe und Unterstützung
Angesichts der Gefahr von Vereinsamung und dem Rückzug ins Private mit zunehmendem Alter spielen nachbarschaftliche Beziehungen eine entscheidende Rolle. Eine Bindung zu den eigenen vier Wänden und zum Quartier beruht auf dem Gefühl, einen Raum mit gemeinsamen Erlebnissen zu teilen und ermöglicht es den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich darin wiederzufinden und von anderen wahrgenommen zu werden. Das Wohnquartier kann der Ort sein, an dem Gemeinschaft entsteht. Selbst wenn sie nur schwach ausgeprägt sind, fördern langjährige nachbarschaftliche Beziehungen ein Gefühl von Zugehörigkeit und Vernetzung. Die Mehrheit der befragten Personen (74%) gibt an, enge Kontakte zu ihren Nachbarn zu pflegen und fast ein Viertel wünscht sich mehr Kontakte. Während solche Kontakte von allen als positiv bewertet werden, sind sie besonders wichtig für die Schwächsten: Über die Hälfte der Personen über 85 und besonders jene mit gesundheitlichen Problemen erachten solche Unterstützung als unverzichtbare Ressource im Alltag. Angesichts der Zunahme der allein wohnenden Menschen wird sich diese nachbarschaftliche Nähe in der Zukunft als zentral erweisen. Die Solidarität im Quartier kann durch den Aufbau von Unterstützungsnetzwerken oder «Caring Communities» gefördert werden. Solche Massnahmen erfordern eine Neuausrichtung der Leistungen sowie die Stärkung der fachlichen Kompetenzen der sozialen Begleitung. Die Rolle von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern beim begleiteten Wohnen oder von Nachbarschaftskoordinatorinnen und -koordinatoren ist ein gutes Beispiel dafür.
In Anlehnung an den Age Report V, Wohnen, Altwerden und Nachbarschaft. V. Hugentobler & A. Seifert (dir.), 2024.