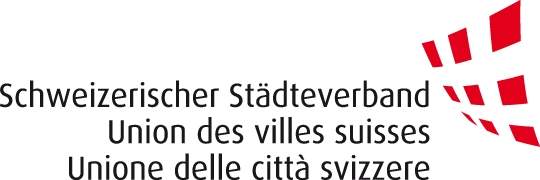Städte wollen Tempo 30: Leiser, sicherer – und besser für alle
Die Debatte um Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen ist bisweilen hitzig und emotional. Ein möglicher Grund dafür ist der Fokus aufs Auto. Denn der Ärger, der vermeintlich von Tempo 30 ausgeht, ist derjenige des Autolenkenden, der sich zurückgebunden fühlt. Eine Mehrheit der Bevölkerung fährt zuweilen ein Auto; doch ebenso benutzt eine Mehrheit der Menschen Strassenräume auch anderweitig: unterwegs zu Fuss oder auf dem Velo, verweilend im Café, oder flanierend auf Shoppingtour. An diesen so genannten verkehrsorientierten Strassen wohnen zudem viele Menschen, Dreiviertel der Bevölkerung leben im urbanen Raum. Im Siedlungsraum sind auch sogenannt verkehrsorientierte Strassen öffentliche Räume; nebst der Erreichbarkeit erfüllen sie zahlreiche verschiedene Anforderungen. Wird Tempo 30 nicht durch die einseitige Brille des Autolenkenden betrachtet, springen viele Vorteile ins Auge:
- Sicherere Geschwindigkeiten – sichere Strassen
Durch die erhebliche Reduktion der Reaktionszeit und des Bremswegs kann mit dem Übergang von 50 auf 30 km/h innerorts etwa ein Drittel der schweren Kollisionen vermieden werden. Tempo 30 führt zudem dazu, dass Schulwege entlang von verkehrsorientierten Strassen sicherer sind. Kinder müssen einen durchgängigen Schulweg sicher zu Fuss oder mit dem Velo absolvieren können. Menschen zu Fuss oder auf dem Velo fühlen sich neben Autos mit Tempo 30 sicherer. Auch Autofahrende fühlen sich letztlich wohler, wenn sie mit sicheren Geschwindigkeiten unterwegs sind.
- Weniger Lärm – gesünderes Leben
Der Strassenverkehr ist die mit Abstand grösste Lärmquelle. Die einfachste, kostengünstigste und effizienteste Massnahme ist die Temporeduktion. Strassenlärm verursacht 80 Prozent der lärmbedingten externen Kosten. Hauptleitragende ist die Bevölkerung in Städten und Agglomerationen. Insgesamt sind 1,1 Millionen Menschen am Tag und 1 Million Menschen in der Nacht übermässigem Verkehrslärm ausgesetzt. Die Lärmreduktion durch Tempo 30 sichert die Lebensqualität von Tausenden Anwohnenden von Hauptstrassen, langfristig.
- Weniger Tempo – mehr Lebensqualität
Verkehrsorientierte Strassen liegen oft mitten im stark besiedelten Stadtraum oder führen durch Ortszentren, die lebenswert für alle sein wollen. Die Strassen dienen nicht nur der Erreichbarkeit und Durchfahrt für Autos, sondern werden von verschiedenen Menschen unterwegs mit verschiedenen Verkehrsmitteln genutzt: zu Fuss, auf dem Velo, im öV, etc. An diesen Strassen wohnen, leben und wirtschaften Menschen. Strassenräume sind immer auch Wohn- und Aufenthaltsraum, Einkaufsstrassen mit Läden, Cafés und Restaurants. Fährt der motorisierte Verkehr langsamer, braucht er weniger breite Fahrbahnen; es bleibt dadurch mehr Platz für die anderen Nutzungen des Strassenraums, für Menschen zu Fuss, mit Rollator oder mit Velo und für schattenspendende Bäume. So trägt Tempo 30 zur Koexistenz aller und zur Klimaverträglichkeit bei.
- Niedrigere Geschwindigkeiten – flüssigeres Fahren
Autofahrende sind dank Tempo 30 in weniger schweren Verkehrskollisionen verwickelt und verursachen weniger Lärm. Doch das ist nicht alles: Bei einer konstanteren Geschwindigkeit von 30 km/h nehmen die Anzahl und das Ausmass der Beschleunigungs- und Bremsmanöver ab, wodurch der rollende Verkehr flüssiger wird. Die Kapazität des MIV-Netzes wird damit erhöht. Studien zeigen, dass die Reisezeit für Autofahrende nach Einführung von Tempo 30 sogar abnimmt.
Weitere Vorteile von Tempo 30 listet das Positionspapier «Geschwindigkeiten für lebenswerte Städte» der Städtekonferenz Mobilität auf.
Herausforderung Motion Schilliger
Entgegen den oben formulierten und weltweit erprobten und bewiesenen Vorteilen von Tempo 30 für lebenswerte Strassenräume und entgegen der laut postulierten Interessen der Städte und Gemeinden, selbst entscheiden zu dürfen, wie sie ihr Temporegime auf ihren Strassen gestalten, haben die eidgenössischen Räte eine Motion an den Bundesrat überwiesen, die für verkehrsorientierte Strassen innerorts grundsätzlich Tempo 50 festlegen will. Der Bundesrat schlägt nun zur Umsetzung vor, dass Tempo 30 erst dann eingeführt werden darf, wenn ein grundsätzlich zu verbauender Flüsterbelag den Lärm nicht genügend zu senken vermag. Damit greift der Bund übermässig und ohne Not in die innerkantonale Organisationsautonomie ein und verordnet den Strassenraum schwächende Massnahmen. Er reduziert Tempo 30 auch zu einer reinen Lärmbekämpfungsmassnahme und vernachlässigt die wesentlichen Vorteile eines humanen Temporegimes.
Städten und Gemeinden, die sich ganzheitlich um ihren Siedlungsraum kümmern müssen, sind die Vorteile von Tempo 30 bewusst. Sie kennen die Situation vor Ort, planen gründlich und wägen bereits heute verantwortungsvoll ab, wo und wie sie welche Verkehrsmassnahmen im Interesse ihrer Bevölkerung umsetzen.
Gestützt durch die Bevölkerung
Paris, Helsinki, Bologna, die Liste der Städte und Gemeinden im Ausland ist lang, die Tempo 30 zur Norm und 50 zur Ausnahme machen. Ticken Schweizerinnen und Schweizer also einfach anders? Zumindest die Teilnehmenden einer Studie von gfs.bern im Auftrag der Städtekonferenz Mobilität zeichnen ein klares Bild. Sie wünschen sich, dass Strassenräume weiter in Lebensräume transformiert werden.
Der Städteverband wird sich an der laufenden Vernehmlassung einbringen und sich gegen einseitig verordnete Vorgaben wehren. Denn die Städte sorgen weiterhin für ihre Bevölkerung und wollen die Städte zu lebendigen und vielfältigen Lebensräumen weiterzuentwickeln.