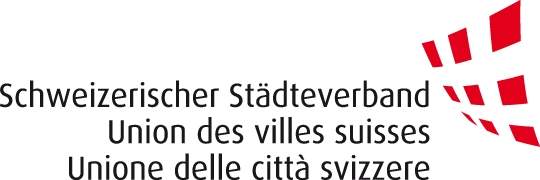Situation auf dem Wohnungsmarkt beschäftigt auch Sozialhilfe
Die Sozialhilfequote hat sich im vergangenen Jahr mit einer Abweichung von -0,1 Prozent zum Vorjahr über die Gesamtheit der 14 im Kennzahlenbericht ausgewerteten Städte kaum verändert. Eine zunehmende Herausforderung für die Sozialhilfe ist dagegen die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Im Fokuskapitel des aktuellen Kennzahlenberichts wurden die Sozialdienste in den Städten nach ihrer Situation befragt. Unisono schätzen sie das Angebot an günstigem Wohnraum generell als zu klein ein. Dies gilt auch für den verfügbaren gemeinnützigen Wohnraum. 16 von 20 befragten Sozialdiensten geben an, dass die Zahl der Menschen, die akut von Wohnungsverlust bedroht sind, in den letzten fünf Jahren zugenommen habe und sie von der Verdrängungstendenz auf dem Wohnungsmarkt meist die Erstbetroffenen sind. «Neben finanziell eng gesetzten Grenzen, die den Sucherfolg einschränken, kommen die Stigmatisierung und der stetig drohende Verlust der eigenen vier Wände erschwerend hinzu», sagt Michelle Beyeler, Privatdozentin für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und Autorin des Fokuskapitels «Wohnen und Sozialhilfe».
Gesamtgesellschaftliches Problem trifft Armutsbetroffene zuerst
Dies hat auch Konsequenzen für die Sozialdienste, die zunehmend mit der Aufgabe betraut sind, Wohnraum zu vermitteln, mit Vermietern nach Lösungen zu suchen und andere Lösungsansätze auszuloten, mit dem Ziel, dass Sozialhilfebeziehende eine stabile Wohnsituation finden oder behalten können. Lösungsansätze reichen von der Anpassung von Mietzinslimiten oder Überbrückungsleistungen für Mietkosten über Beratung und Vermittlung bis zu Kooperationen mit Hausverwaltungen, Vermietern oder Stiftungen. «Doch auch ihr Spielraum hat Grenzen», sagt Nicolas Galladé, Präsident der Städteinitiative Sozialpolitik, «da die Wohnraumknappheit ein generelles Problem darstellt, das die Sozialhilfe nicht lösen kann.»
Hinzu kommt die systematische Aufwertung von Wohnraum, die zu kontinuierlichen Mieterhöhungen führt. «Die überwiegende Mehrheit der Sozialhilfeempfänger sind Mietende. Ihnen dabei zu helfen, ihre Rechte geltend zu machen, insbesondere um sich gegen ungerechtfertigte Mieterhöhungen zu wehren, bedeutet, ihnen zu ermöglichen, eine bezahlbare Wohnung und ihr soziales Leben vor Ort zu behalten», betont Vizepräsidentin Émilie Moeschler.
Systematische Auswertungen in den Schweizer Städten zu diesem Thema gibt es nur vereinzelt, weshalb sich die Sozialdienste auf Einzelfallbeobachtungen oder Rückmeldungen aus institutionellen Netzwerken stützen. Diese Einschätzungen hat Autorin Michelle Beyeler methodisch ausgewertet und zusammengefasst.
Teilnahme von 20 Städte aus West- und Deutschschweiz
Weil das Thema auch Westschweizer Städten unter den Nägeln brennt, haben nebst den 14 konstant teilnehmenden Kennzahlenstädten (zu welchen auch Biel und Lausanne zählen) sechs weitere Städte aus der Romandie an der Befragung zur Wohnsituation teilgenommen: Genf, Neuenburg, Freiburg, La Chaux-de-Fonds, Sitten und Yverdon. Die wachsenden Herausforderungen sind insgesamt vergleichbar mit jenen der Deutschschweiz.
Modernisierung der Sozialhilfestatistik
Den Standardteil des Kennzahlenberichts verfasst das Bundesamt für Statistik. Die Sozialhilfestatistik befindet sich zurzeit in einer Modernisierungsprojekt. Die zweijährige Umstellungsphase führt dazu, dass Veränderungen zwischen den Jahren 2023 und 2024 beschränkt aussagekräftig sind und mit Vorsicht interpretiert werden müssen. Die Vorteile der Modernisierung sind bedeutend: Kennzahlen stehen schneller zur Verfügung und sowohl die Datenqualität als auch das Auswertungspotential werden erhöht. Der statistische Kennzahlenvergleich auf Basis der Sozialhilfestatistik des BFS ist ein unerlässliches Instrument der städtischen Sozialdienste.
Gut zu wissen
Die Sozialhilfequote gibt an, wie hoch der Anteil der Sozialhilfebeziehenden an der ständigen Wohnbevölkerung in einem Kalenderjahr ist. Zu den Sozialhilfebeziehenden eines Kalenderjahres werden alle Personen gezählt, die in mindestens einem Monat eine finanzielle Unterstützung der wirtschaftlichen Sozialhilfe erhalten haben. Die Sozialhilfequote der Schweiz insgesamt betrug im Jahr 2023 2,8 %. Die Sozialhilfequoten sind in der Regel in ländlichen Gebieten tiefer als in städtischen Zentren.
Die Kennzahlen zur Sozialhilfe in Kürze
Sozialhilfezahlen bleiben konstant: Über alle Städte kombiniert gesehen gibt es nur geringfügige Veränderungen zum Vorjahr.
Zunahme aufgrund von Bevölkerungswachstum: Die Anzahl unterstützter Personen nimmt leicht zu, aber weniger stark als das Bevölkerungswachstum, weshalb die Sozialhilfequote gesamthaft leicht rückläufig ist.
Wohnen und Sozialhilfe: Die schwierige Wohnungssituation in den Städten mit sehr tiefen Leerwohnungsziffern steht im Fokus des diesjährigen Kennzahlenberichts. Dazu wurden zusätzlich sechs Städte aus der Romandie (Genf, Neuenburg, Freiburg, La Chaux-de-Fonds, Sitten und Yverdon) befragt.
Zu wenig günstiger Wohnraum: Die angefragten Sozialdienste schätzten das Angebot an günstigem Wohnraum generell als zu klein ein. Zur selben Einschätzung gelangten sie bezüglich des Angebots an gemeinnützigem Wohnraum respektive Wohnraum nach dem Prinzip der Kostenmiete (Miete entspricht den tatsächlich anfallenden Kosten des Vermieters, ohne dass ein Gewinn erzielt wird).
Verdrängungstendenz nimmt zu: 16 von 20 angefragten Sozialdiensten schätzen, dass die Anzahl der Menschen, die akut von Wohnungsverlust bedroht ist, in den letzten fünf Jahren zugenommen habe.
14 Städte im Vergleich: Im aktuellen Kennzahlenbericht «Sozialhilfe in Schweizer Städten» sind 14 Städte vertreten: Basel, Bern, Biel, Chur, Lausanne, Luzern, St. Gallen,
Modernisierung der Sozialhilfestatistik: Die Umstellung führt dazu, dass Veränderungen zwischen den Jahren 2023 und 2024 nicht immer auf Entwicklungen vor Ort, sondern auf definitorische Verbesserungen zurückzuführen sind. Entwicklungen sind teilweise nur beschränkt aussagekräftig und müssen vorsichtig interpretiert werden.
Faktenbasierte wissenschaftliche Erkenntnisse: Der Standardteil wurde vom Bundesamt für Statistik auf der Basis der Schweizerischen Sozialhilfestatistik erstellt. Das Fokuskapitel «Die Sozialhilfe in Zeiten der Wohnungsnot: Entwicklungen, Herausforderungen und Handlungsansätze» wurde von Michelle Beyeler, Privatdozentin für Politikwissenschaft an der Universität Zürich, erarbeitet. Auftraggeberin ist die Städteinitiative Sozialpolitik. |