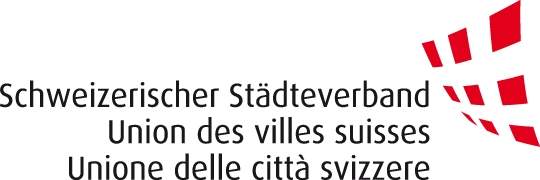«Ein Eingriff in die Gemeindeautonomie ist der falsche Weg»
Welchen Stellenwert hat Tempo 30 für die Stadt Aarau?
Aaraus Quartierstrassen sind heute praktisch flächendeckend verkehrsberuhigt. Die Stadt nimmt auch bei Umbau- und Umgestaltungsprojekten von Hauptstrassen eine Güterabwägung zwischen Tempo 50 und Tempo 30 vor. Beim Kanton setzt sich die Stadt seit Jahren dafür ein, dass die Güterabwägung zwischen Tempo 50 und Tempo 30 in die Planung der städtischen Strassenräume einfliesst.
Wie akzeptiert ist Tempo 30 in der Bevölkerung?
Tempo 30 auf Quartierstrassen ist von der Bevölkerung und den Verkehrsteilnehmenden akzeptiert. Beim Projekt Bahnhofstrasse gab es vor allem anfänglich nebst den positiven auch kritische Stimmen. Insbesondere ältere und beeinträchtigte Menschen hatten Mühe mit dem flächigen Queren der Strasse ohne Fussgängerstreifen. Im Rahmen des Strassenbauprojekts braucht es noch bauliche Verbesserungen. Die kritischen Stimmen wurden aber im Verlaufe des Testbetriebs immer weniger. Ich bin überzeugt, dass die städtische Bevölkerung heute klar hinter Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse steht.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Kanton, gerade beim Projekt Bahnhofstrasse? Konnten die städtischen Interessen ausreichend eingebracht werden?
Die Zusammenarbeit mit dem Kanton gestaltete sich sehr gut. Man nahm unsere Anliegen ernst und war gewillt, eine gemeinsam getragene, gute Lösung umzusetzen. Der vom Kanton gewählte Projektname «Mitenand statt Gägenand» war und ist passend. Im dichten städtischen Raum kann der Verkehr nur gemeinsam bewältigt werden, mit gegenseitiger Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden.
Die Bahnhofstrasse ist jetzt sicherer und hat mehr Aufenthaltsqualität. Geht das zulasten der Autofahrenden?
Nein, die Auswertung des Testbetriebs hat klar gezeigt, dass sich die Reisezeiten für die Autofahrenden sogar verbessert haben. Das Projekt Bahnhofstrasse ist auch für die Autofahrenden von Vorteil, was sicher auch damit zusammenhängt, dass das Vorhaben nicht eine reine Temporeduktion, sondern auch die Aufhebung einer Lichtsignalanlage bei einer Kreuzung und die Aufhebung eines Linksabbiegers beinhaltete. Das Projekt besteht somit aus einem Bündel fein aufeinander abgestimmter Massnahmen, Tempo 30 ist ein wichtiger Teil davon.
Was können andere Städte aus den Erfahrungen von Aarau mit Tempo 30 lernen?
Sehr wichtig ist ein gutes Monitoring – vorher und nachher müssen genau verglichen werden können. Die Umsetzung im Rahmen eines Testbetriebs erwies sich ebenfalls als richtig. Einerseits konnte die Strassengestaltung in der Hälfte des Testbetriebs wie vorgesehen geändert werden (mit und ohne Radstreifen). Es war also möglich, verschiedene Situationen zu testen. Der Testbetrieb bot auch die Möglichkeit, kurzfristig zu reagieren bzw. Optimierungen vorzunehmen. In der Vorweihnachtszeit entstanden bei der Ausfahrt eines öffentlichen Parkings lange Wartezeiten, was zu vielen Reklamationen führte. Dank kurzfristigen Massnahmen in einer Zufahrtsstrasse zur Bahnhofstrasse konnten diese Schwierigkeiten behoben werden. Nachdem die Auswertung des Testbetriebs zeigte, dass die gesteckten Ziele erreicht wurden – z.B. Verbesserung des Verkehrsablaufs für alle Verkehrsteilnehmenden, Erhöhung der Fahrplanstabilität des öffentlichen Verkehrs –, lag die definitive Verkehrsanordnung (Tempo 30) öffentlich auf. Während gegen die öffentliche Auflage des Testbetriebs Einsprachen eingingen, war dies bei der definitiven Verkehrsanordnung nicht mehr der Fall. Der Testbetrieb hat auch klar gezeigt, dass Veränderungen Zeit brauchen.
Die Städte wollen Tempo 30 auf Hauptachsen einfacher umsetzen können, der Bund nicht. Wie sehen Sie die Zukunft?
Ich bin überzeugt, dass die Städte und Gemeinden am besten entscheiden können, welche Höchstgeschwindigkeiten auf ihrem Gebiet gelten sollen. Eine Überregulierung durch den Bund und der vorgesehene Eingriff in die Gemeindeautonomie sind der falsche Weg. Im Übrigen bin ich überzeugt, dass Hauptstrassen(abschnitte) im dicht besiedelten städtischen Gebiet viele Zwecke erfüllen müssen und nicht einfach «verkehrsorientiert» sind. Für die Stadt Aarau ist der fragliche Teil der Bahnhofstrasse keine «verkehrsorientierte», sondern eine «siedlungsorientierte» Strasse. Das zeigt allein die Tatsache, dass auf der Bahnhofstrasse mehr Fussgängerinnen und Fussgänger unterwegs sind als Autofahrende.