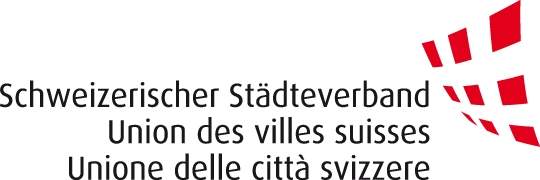Asylstrategie 2027: Asylsystem wird gezielt verbessert
Bund, Kantone, Gemeinden und Städte haben die Asylstrategie 2027 gemeinsam erarbeitet. Grundlage der Strategie bildet eine externe Analyse und daraus abgeleitet eine politische Synthese. Die drei Staatsebenen bekennen sich darin zum heutigen Asylsystem und zur Integrationsagenda Schweiz. Sie anerkennen, dass sich die 2019 eingeführten beschleunigten Asylverfahren grundsätzlich bewährt haben, trotz Pandemie und hoher Belastung des Asylwesens. Sie stützen die heutige Aufgabenteilung und bekennen sich dazu, dass jede Staatsebene auch künftig die ihr im Gesetz zugeschriebenen Aufgaben und Zuständigkeiten verlässlich wahrnimmt und genügend Mittel dafür vorsieht. Gleichzeitig haben Bund, Kantone, Gemeinden und Städte festgestellt, dass in verschiedenen Bereichen konkreter Handlungsbedarf besteht und das Asylsystem insbesondere in Phasen starker Belastung an Grenzen stösst und an Effizienz einbüsst. Sie werden deshalb das Asylsystem gemeinsam weiterentwickeln und verbessern.
Besser auf Krisen vorbereiten
Handlungsbedarf besteht bei der Schwankungstauglichkeit und bei den Asylverfahren. In den Bereichen Unterbringung und Personalressourcen soll das System schwankungstauglicher werden, damit die Herausforderungen bei einem raschen Anstieg der Asylgesuche schneller gemeinsam gemeistert werden können. Die Verfahren sind weiter zu beschleunigen, da sie teilweise deutlich länger dauern als ursprünglich vorgesehen, was namentlich Kantone und Gemeinden belastet. Zudem wird ein vorgelagertes Verfahren geprüft, um die Strukturen von Personen zu entlasten, die keine Verfolgung geltend machen und somit nicht schutzbedürftig sind.
Handlungsbedarf besteht auch bei den Themen irreguläre Migration und Kriminalität. Um die Akzeptanz des Asylsystems zu stärken und um die Handlungsfähigkeit des Asylsystems im Umgang mit straffälligen Personen zu verbessern, sollen Gesetzesanpassungen geprüft werden. Zusätzlich wollen Bund, Kantone, Gemeinden und Städte den Wegweisungsvollzug von ausreisepflichtigen Personen stärken und die bestehende Taskforce gegen Intensivtäter gemeinsam weiterentwickeln. Der Bund soll dafür auch die Zusammenarbeit mit wichtigen Herkunfts- und Transitländern vertiefen.
Handlungsbedarf besteht weiter beim Schutzstatus S. Dieser wurde vor der Neustrukturierung des Asylsystems konzipiert und soll nun besser in das Gesamtsystem eingebettet werden. Dies etwa in Bezug auf Reisefreiheit, Erwerb und Sozialhilfe. Bund, Kantone, Gemeinden und Städte wollen eine klare Regelung für die Aufhebung des Schutzstatus S oder den Übergang zum Status B nach fünf Jahren erarbeiten.
Die Integration von Geflüchteten verläuft insgesamt erfreulich, dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf – insbesondere bei der Integration von Frauen und jungen Erwachsenen. Mit gezielten Massnahmen wollen Bund, Kantone, Städte und Gemeinden erreichen, dass sich diese beiden Personengruppen nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren können und deren Teilhabe an der Gesellschaft gefördert wird. Die drei Staatsebenen bekennen sich dafür weiterhin zur Umsetzung der Integrationsagenda und streben zugleich an, diese noch wirksamer und verbindlicher zu gestalten.
Zweite Phase mit konkreten Massnahmen
Die Asylkonferenz und die Verabschiedung der Asylstrategie 2027 markieren den Abschluss der ersten Phase und gleichzeitig den Start des zweiten Teils der Arbeiten. Bund, Kantone, Gemeinden und Städte werden nun die identifizierten Verbesserungsoptionen umgehend an die Hand nehmen und parallel dazu weitere konkrete mittel- und langfristige Massnahmen ausarbeiten und umsetzen.
Mit dem politischen Mandat unterstreichen Bund, Kantone, Gemeinden und Städte ihre gemeinsame Vorstellung sowie ihre gemeinsame Verantwortung für ein menschenwürdiges, rechtstaatliches, funktionsfähiges und effizientes Asylwesen – auch unter schwierigen Bedingungen.