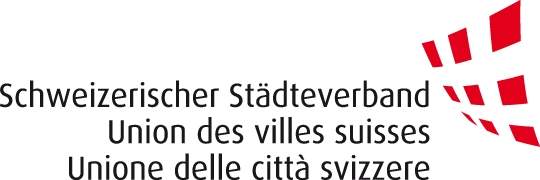Veranstaltung des SSV vom 23. Februar 2023
Mit der Veranstaltung «Frauenfeld: So gelingt Agglomerationspolitik» hat der Schweizerische Städteverband am 23. Februar seine neue Reihe «Der Puls der Agglomerationen» lanciert. Anders Stokholm, Stadtpräsident von Frauenfeld und Präsident des Städteverbands, begrüsste die rund 50 Teilnehmenden aus Politik und Verwaltung zum Austausch über die Erfahrungen und Herausforderungen der Agglomeration Frauenfeld und einer angeregten Diskussion über die Ausgestaltung der Agglomerationspolitik.
Am Puls der Agglomerationen
Die Veranstaltung am Puls der Agglomerationen in Frauenfeld bildete den Auftakt der SSV-Aktivitäten zu, in und mit Agglomerationen im Jahr 2023.
Anders Stokholm erläuterte den Teilnehmenden einleitend die Bedeutung der Agglomerationen für die Schweiz, wofür sich der Städteverband stark macht. Die Agglomerationen sind zentrale Lebens- und Wirtschaftsräume der Schweiz. Heute umfassen die statistisch festgelegten Agglomerationskerne und -gürtel 49 Agglomerationen. In diesen Räumen leben drei Viertel der Bevölkerung. Von der Schweizer Wirtschaftskraft wird über 80 Prozent in den Agglomerationen erwirtschaftet. Damit zeigt sich die urbane Schweiz mit ihren Agglomerationen als eindrückliche Leistungsträgerin.
Die Raumplanungsgesetzgebung des Bundes verlangt seit 2014, dass sich die Stadtentwicklung nach innen richtet und ressourcenschonend gestaltet wird. Entsprechend gilt es das anstehende Bevölkerungswachstum aufzunehmen, die räumlichen Prozesse mit den sozialen Entwicklungen zusammen anzupacken, ohne dass die Lebensgrundlagen zerstört werden. Agglomerationen sind somit die zentralen Handlungsräume für Planung und Politik. Sie haben trotz grosser Vielfältigkeit ähnliche Chancen und gemeinsame Herausforderungen, Lösungen sollen jedoch situationsbezogen und kontextspezifisch ausfallen. Der Städteverband leistet hierzu als gemeinsame urbane Stimme in Bundesbern und als Austauschplattform für seine Mitglieder einen wichtigen Beitrag.

Ein Agglomerationspapier für die SSV-Mitglieder
Agglomerationspolitik 2024+
Weitere Informationen
2023 ist ein wichtiges Jahr für die Zukunft der Agglomerationspolitik. Zurzeit läuft die Erarbeitung der Agglomerationspolitik 2024+ unter Federführung des Bundesamts für Raumentwicklung ARE. «Im Vordergrund stehen für uns Massnahmen, die Gesellschaft, Raum und Umwelt zusammendenken.», so SSV-Direktor Martin Flügel in seinem Einführungsreferat, in dem er die Positionen des Städteverbands präsentierte.
1. Aus Sicht des Städteverbands müssen die «Agglomerationsprogramme Siedlung und Verkehr» weitergeführt und verstetigt werden. Dabei sind der öffentliche Verkehr sowie der Fuss- und Veloverkehr zentral für die Weiterentwicklung der Lebensqualität in den Agglomerationsräumen. Die Idee der 15-Minuten Stadt ist dabei ein Zielbild, das hier verfolgt werden kann.
2. Die Agglomerationspolitik soll sich nicht auf Infrastrukturprojekte beschränken, sondern auch sozialräumliche Aspekte der Siedlungsentwicklung, Fragen der Umweltgerechtigkeit, des Wohnumfeldes und des sozialen Zusammenhaltes berücksichtigen. Denn nur so kann die Schweiz ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen. Das 2016 gegründete Netzwerk Lebendige Quartiere, das Austausch und Vernetzung von Fachpersonen aus der Quartierentwicklung und sozialräumlichen Arbeit ermöglicht, muss dafür weitergeführt werden. Einen Ausbau zu einem Programm «Zusammenleben und Zusammenhalt» begrüsst der Städteverband.
 |
7. März 2023 – Die urbane Schweiz braucht eine starke und vielfältige Agglomerationspolitik |
| Ein Positionspapier des Schweizerischen Städteverbands |
Beispiele aus Frauenfeld
«Mein Weg – unser Netz»
Wie eine erfolgreiche und nachhaltige Agglomerationspolitik gelingen kann, erfuhren die Teilnehmenden anhand von zwei aktuellen Beispielen aus der Agglomeration Frauenfeld.
Sabina Ruff, Leiterin der Abteilung Sozialraum bei der Stadt Frauenfeld, präsentierte das Modellvorhaben «Mein Weg - unser Netz». Die Regio Frauenfeld zeigt damit exemplarisch für ein Frauenfelder Quartier und drei Gemeinden der Region, wie alte Fusswege wieder zu neuem Leben erweckt und vernetzt werden können. Die Bevölkerung soll ihr Wissen zu alten Fusswegen und auch die Alltagsbedürfnisse in das Projekt einbringen. Zusammen mit verschiedenen Ziel- und Altersgruppen – wie z.B. Schüler/-innen oder Senior/-innen – werden Antworten zu folgenden Fragen gesucht: Wo schränken fehlende Wege und Verbindungen unser Bewegungsverhalten ein? Wo können neue attraktive, erlebnisreiche und eigenständige Verbindungen abseits der vom motorisierten Verkehr dominierten Strassen geschaffen werden?
Die Arbeit lohne sich, ist Sabina Ruff überzeugt: «Denn attraktive Fusswege regen zur Entdeckung an, machen Lust zur Bewegung, laden zum Verweilen ein und erhalten die Gesundheit.» Schliesslich hat das gebaute Umfeld grossen Einfluss auf das Verhalten der Menschen und indirekt auf die Gesundheitskosten. Räume, die Bewegung und Begegnung fördern, dazu einladen, steigern nämlich nachweisbar die Gesundheit und reduzieren somit die Gesundheitskosten.
Aufwertung Strassenräume Innenstatdt
Im Rahmen des Projekts «Aufwertung Strassenräume Innenstadt» sollen in den nächsten fünf Jahren diverse Strassenräume in der Frauenfelder Innenstadt mit hoher Priorität geplant, projektiert und umgesetzt werden. Dies haben die Frauenfelder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 15. Mai 2022 an der Urne beschlossen und den Baukredit mit einem Mitwirkungsversprechen bewilligt.
Stadtrat Andreas Elliker und der Stadtingenieur Sascha Bundi stellten das Projekt und dessen Erfolgsfaktoren vor. Der frühe Grundsatzentscheid habe Planungssicherheit geschaffen und setzt die Rahmenbedingungen für den Mitwirkungsprozess. Voraussetzung dafür sei der Mut gewesen, bestehende Prozesse zu hinterfragen. Die Mitwirkung innerhalb definierter Rahmen ist dabei essenziell. Die Projektverantwortlichen sehen diese als Chance und setzen sie bewusst auch nur dort ein, wo es Handlungsspielraum gibt. Stadtingenieur Sascha Bundi erklärte dazu: «Der Weg zur Lösung ist ebenso wertvoll wie die Lösung selbst.»
Podium: Wie gelingt Agglomerationspolitik?
An der anschliessenden Podiumsdiskussion tauschten sich VertreterInnen von Bund, Kantonen und Städten darüber aus, wie eine wirkungsvolle Agglomerationspolitik gelingen kann. Einig waren sich die Podiumsteilnehmenden, dass Zusammenarbeit und Partizipation sowie eine gute Kommunikation wichtige Erfolgsfaktoren sind.
Der Begriff der Agglomerationspolitik ist schwer zugänglich und stellt für alle beteiligten Staatsebenen eine Herausforderung bei der Vermittlung dar, auch darüber bestand Einigkeit in der Diskussionsrunde. Eine gemeinsame, einfache und gezielte Kommunikation sei notwendig, um das Verständnis für die Politik bei der Bevölkerung zu schaffen. Ausserdem sei es erfolgversprechender, über die einzelnen Projekte zu kommunizieren als über die Agglomerationspolitik als Ganzes.
Die Zusammenarbeit der Staatsebenen funktioniere bei der Agglomerationspolitik in Frauenfeld grundsätzlich gut. Andreas Elliker merkte dazu aber auch kritisch an: «Mehr Agilität und beschleunigte Prozesse seitens Bund sind für die Stadt Frauenfeld wichtig». Unter anderem seien die gleichzeitigen Einreichungsfristen für alle 49 Agglomerationen für alle Beteiligten – von den Verwaltungen bis zu den spezialisierten Planungsbüros – eine grosse Herausforderung und eine Flexibilisierung könne hier allenfalls Abhilfe schaffen, ergänzte Andrea Näf, Leiterin des Amts für Raumentwicklung des Kantons Thurgau. Andrea Näf machte zudem auf eine weitere Herausforderung aufmerksam: «Wir sehen, dass in den kleineren und mittleren Agglomerationen die Hürden für Agglomerationsprogramme mit grösseren Massnahmen sehr hoch sind. Denn für substanzielle Infrastrukturanpassungen fallen vergleichsweise hohe Kosten pro Kopf an, weil weniger Menschen in diesen Agglomerationsräumen leben. Über eine Anpassung der Beurteilungskriterien muss deshalb nachgedacht werden.» Diese wichtige Anliegen nimmt der Städteverband auch in die laufenden Gespräche mit dem Bund mit.
Isabel Scherrer, Leiterin Sektion Agglomerationsverkehr beim Bundesamt für Raumentwicklung, zeigte Verständnis für die Anliegen, relativierte aber gleichzeitig: «Die Agglomerationsprogramme sind angesichts ihrer Tragweite ein junges Projekt. Alle drei Staatsebenen mussten viel lernen, auch in Bezug auf die Zusammenarbeit. In der vierten Generation haben wir viel zur Beschleunigung beigetragen und wir verbessern uns fortlaufend. Die gleichzeitige Einreichung der Gesuche und gute Abstimmung mit der Strategischen Entwicklungsplanung Strasse (STEP Strasse) ist jedoch eine Vorgabe der Politik, an die wir uns halten müssen.»
Schliesslich ist eine gelingende und raumwirksame Agglomerationspolitik nur als Verbundsaufgabe zu meistern. Für die Abschlussrunde bat Monika Litscher, Vize-Direktorin des Städteverbands und Moderatorin der Veranstaltung, deshalb die Podiumsteilnehmenden den Satz zu vervollständigen «Agglomerationspolitik gelingt, wenn wir als….» und erhielt die folgenden Antworten:
- «…Stadt unsere Hausaufgaben machen.» (Andreas Elliker, Stadtrat Frauenfeld)
- «…Kanton unsere Vermittlerrolle zwischen Bund und Gemeinden optimal wahrnehmen.» (Andrea Näf, Leiterin Amt für Raumentwicklung, Kanton Thurgau)
- «…Bund ambitionierte Ziele setzen und uns kontinuierlich verbessern.» (Isabel Scherrer, Leiterin Sektion Agglomerationsverkehr, Bundesamt für Raumentwicklung)
- «…Städteverband die Forderungen gegenüber dem Bund proaktiv einbringen und als Austauschplattform für best und bad practices dienen, um voneinander zu lernen.» (Anders Stokholm, Präsident Städteverband)